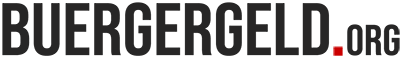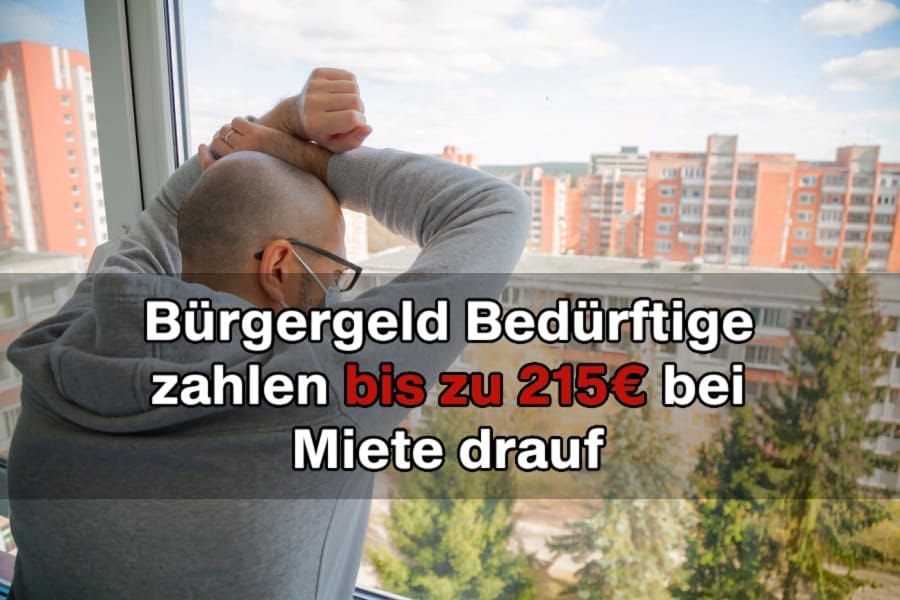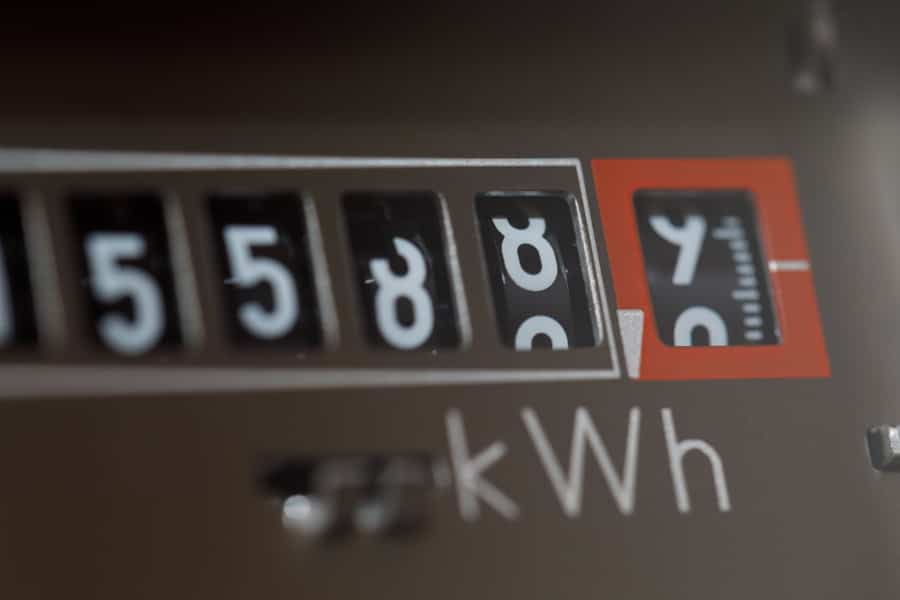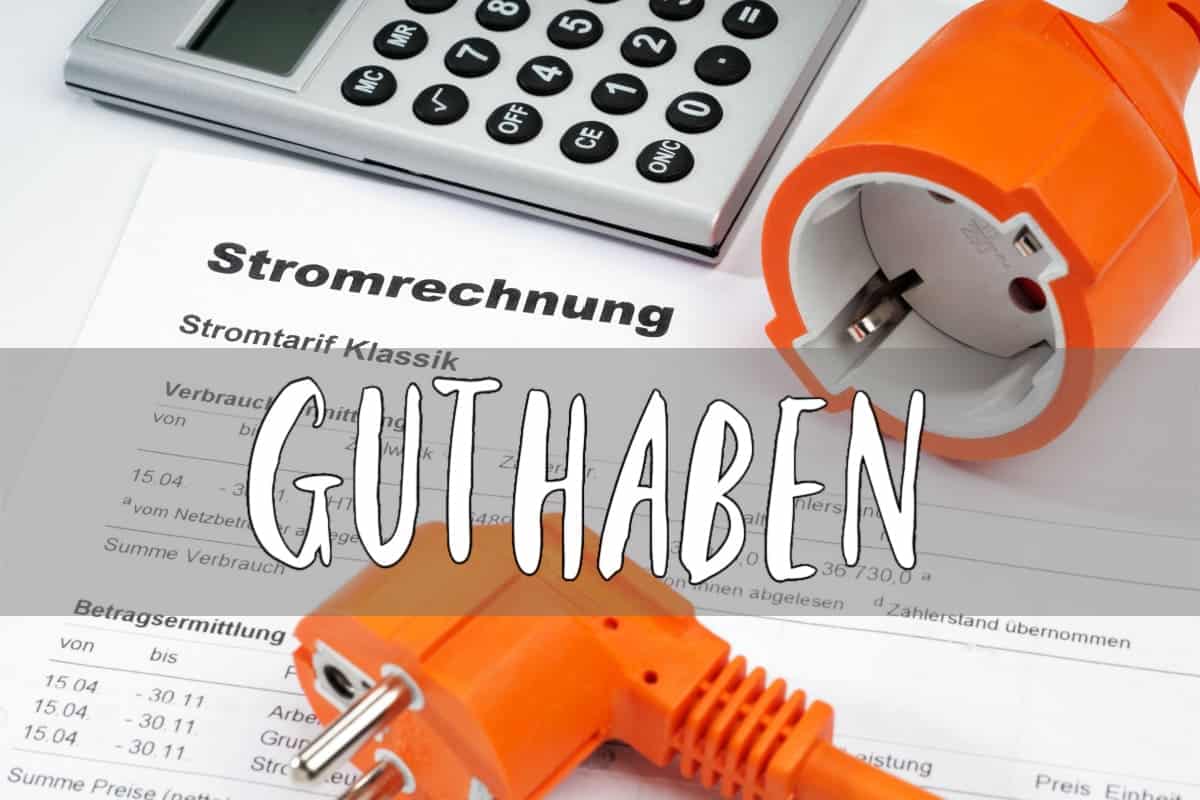Die Miete von Bürgergeldempfängern muss angemessen sein. Doch was heißt das? Darüber wird seit Ewigkeiten gestritten. Während Jobcenter auf Tabellen und Grenzwerte zurückgreifen, gehen immer mehr Gerichte dazu über, den tatsächlichen Wohnungsmarkt zu berücksichtigen. So auch in einem Fall, der vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg am 30.03.2023 verhandelt wurde und bundesweit von Bedeutung sein könnte.
Jobcenter übernahm nur Teil der Miete
Die Klage stammt aus dem Zeitraum 2015/2016. Das Jobcenter weigerte sich, die vollen Kosten für die Wohnung einer Hartz-IV-Empfängerin (heute Bürgergeld) zu übernehmen. Der Warmmiete von 640 Euro standen als angemessen geltende 480 Euro gegenüber. Dabei berief sich die Behörde auf die Ausführungsvorschriften der zuständigen Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Grundlage der Vorschrift und damit der Angemessenheitswerte: Die durchschnittlichen Mieten einfacher Wohnungen gemäß Mietspiegel.
Bürgergeld-Urteil: Höhere Miete bei besonderen Lebensumständen
Wohnungen müssen tatsächlich verfügbar sein
Das LSG Berlin-Brandenburg monierte das Vorgehen des Jobcenters als unzulässig. Berücksichtigt werde nur der durchschnittliche Fall der Angemessenheit. Die obere Grenze bliebe dabei außen vor. Wichtiger aber ist die Einschätzung, dass einfache Wohnungen, auf die das Jobcenter Bürgergeld Bedürftige verweise,
„tatsächlich verfügbar, also anmietbar sind“.
Das werde durch das Konzept in Berlin nicht gewährleistet.
Enorme Angebotslücke
Dazu griffen die Richter auf die Wohnraumstatistik der Senatsverwaltung aus dem Jahr 2019 zurück. Zu der Zeit mussten 76.000 Bürgergeldhaushalte Teile der Miete selbst bestreiten, weil die Miete über den vom Jobcenter genutzten Grenzwerten lagen. Hinzu käme in Berlin eine Angebotslücke von 345.000 Single-Wohnungen.
Unmöglich: Grenzwerte definieren
In einer solch angespannten Lage sei es auch dem Landessozialgericht nicht möglich, einen Grenzwert festzulegen. Auch die Wohngeldtabelle mit einem Aufschlag von zehn Prozent sei für Berliner Verhältnisse ungeeignet. Denn: Selbst nach diesen Maßstäben wären viele Sozialwohnungen unangemessen teuer.
Jobcenter muss zahlen
Ausgehend von der Intention des Gesetzgebers, dass Sozialwohnungen für Hilfebedürftige, damit auch für Bürgergeldempfänger, errichtet und vorgehalten werden sollen, liege der Quadratmeterpreis der Wohnung der Klägerin unterhalb des Durchschnitts der zulässigen Mieten. Daher müsse das Jobcenter die Kosten in voller Höhe übernehmen.
Hier greift der zweite Leitsatz des Urteils: „Wohnraum, der nach den Vorgaben des sozialen Wohnungsbaus und des WoGG (Wohngeldgesetz) angemessen ist, kann jedenfalls in angespannten Wohnungsmärkten nicht grundsicherungsrechtlich unangemessen sein.“
Verfahrensgang:
- Sozialgericht Berlin, Aktenzeichen S 186 AS 773/16 vom 02.08.2017.
- Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Aktenzeichen L 32 AS 1888/17 vom 30.03.2023.
Eine Revision beim Bundessozialgericht ist zulässig, weil das Urteil grundsätzliche Bedeutung hat.
Bild: Lotta Axing/ shutterstock.com