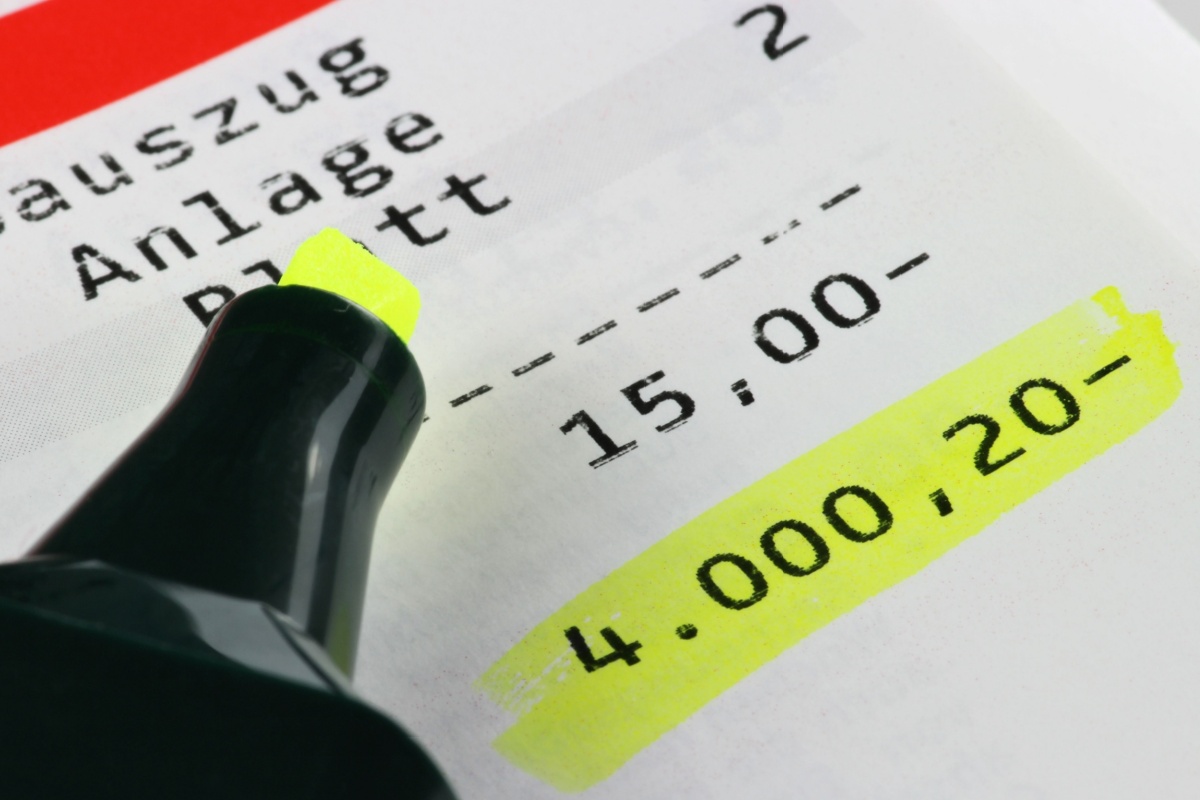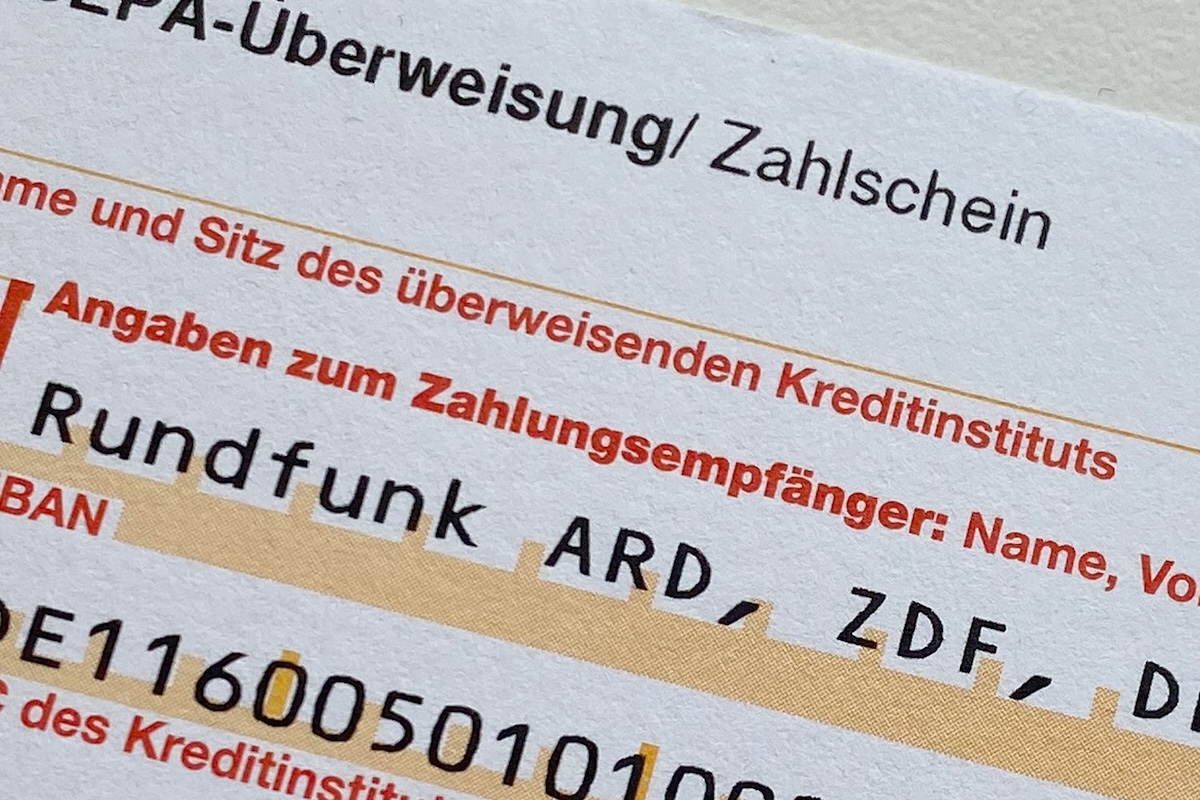2024 meldete das Statistische Bundesamt: Rund 4,2 Millionen Menschen lebten in Haushalten, die Strom- oder Gasrechnungen nicht fristgerecht zahlen konnten. Parallel nahmen Stromsperren deutlich zu. Die Zahlen zeigen ein strukturelles Problem – und treffen nicht nur Menschen mit geringem Einkommen sondern auch Empfänger von Bürgergeld und anderen Leistungen der Grundsicherung besonders hart.
Inhaltsverzeichnis
Destatis-Zahlen: Zahlungsrückstände auf hohem Niveau
Fünf Prozent der Bevölkerung gaben 2024 an, bei Versorgungsbetrieben im Rückstand zu sein. Die amtliche Basis ist EU-SILC. Damit sind nicht nur Einzelfälle erfasst, sondern eine breite Lagebeschreibung. Zusätzlich konnte knapp ein Drittel der Bevölkerung unerwartete Ausgaben nicht aus eigener Kraft stemmen. Beides zusammen deutet auf eine dauerhafte finanzielle Schieflage hin – auch nach dem Abflauen der Energiepreisspitzen.
Jeder Dritte kann unerwartete Ausgaben nicht zahlen
Stromsperren: 2024 plus rund 20 Prozent
Die Bundesnetzagentur beziffert für 2024 etwa 245.000 Stromsperren. Gegenüber 2023 ist das ein Anstieg um rund ein Fünftel respektive 20 Prozent. Auch Gassperren nahmen zu. Vor einer Abschaltung stehen Mahnungen und Sperrandrohungen. Wer dann keinen Ausgleich schafft, sitzt buchstäblich im Dunkeln. Für Beratungsstellen ist das Alltag: Stromschulden wachsen in Stufen – am Ende steht die Sperre.
Was im Preis steckt
Für private Haushalte kostete Strom im zweiten Halbjahr 2024 im Durchschnitt 41,2 Cent pro Kilowattstunde, inklusive aller Gebühren und Abgaben. Die Tarife der Stromversorger enthalten eine feste Grundgebühr. Repräsentative Marktübersichten zeigen zweistellige Beträge pro Monat als Normalfall – unsere eigenen Berechnungen aus 25 Städten zeigen einen Durchschnitt von monatlich etwa 13 € und einen durchschnittlichen Verbrauchspreis von 38 Cent pro Kilowattstunde. Damit frisst der Fixpreis zuerst am kleinen Strombudget. Je kleiner der Haushalt, desto weniger lässt sich der Grundpreis „teilen“.
Jetzt der Blick auf die Grundsicherung
Im Bürgergeld (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und in der Sozialhilfe nach SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt) gilt: Heizkosten und Gasnachzahlungen zählen zu den Kosten der Unterkunft und werden – soweit angemessen – von Jobcenter oder Sozialamt getragen. Haushaltsstrom muss aus dem Regelsatz selbst gezahlt werden. Genau hier entsteht die Lücke.
Singles dominieren in beiden Systemen. Im SGB II stellen Einpersonenhaushalte den größten Teil der Bedarfsgemeinschaften. Auch in der SGB-XII-Grundsicherung ist die Struktur stark von Alleinlebenden geprägt. Für sie wirken Fixkosten unmittelbarer, denn eine Grundgebühr verteilt sich nicht auf mehrere Personen. Eine Nachforderung bei Gas lässt sich häufig über die Unterkunftskosten abfangen. Eine Stromnachforderung landet voll im knappen Regelsatz – und löst die Schuldenkette aus.
Rechenprobe für einen Single
Für einen alleinstehenden Erwachsenen sind im Regelbedarf rechnerisch rund 45,72 Euro für Haushaltsstrom einkalkuliert. Realistische Grundgebühr: 13 Euro im Monat. Bleiben 32,72 Euro für den Arbeitspreis.
Bei 38 Cent je kWh reicht das für rund 86 kWh im Monat. Ein sparsamer Single kommt mit Glück auf 1.200 kWh im Jahr – das sind 100 kWh monatlich. Es fehlt also der Gegenwert von etwa 14 kWh, also knapp 5,32 € im Monat. Liegt der Bedarf näher am typischen Durchschnitt von 1.500 kWh, klafft monatlich eine Lücke von fast 15 €. Diese Unterdeckung ist systemisch. Sie entsteht, ohne dass schon ein Schuldenberg besteht. Aktuell dürfte der Strompreis bei maximal knapp unter 33 Cent liegen, um eine Unterdeckung zu vermeiden – ausgehende von 1.200 kWh-Verbrauch.
Kurz gerechnet
| Annahme (Single) | Betrag/Verbrauch |
|---|---|
| Strombudget im Regelsatz (mtl.) | 45,72 € |
| Grundgebühr (mtl., typisch) | 13,00 € |
| Verbleibend für Arbeitspreis | 32,72 € |
| Reichweite bei 38 ct/kWh | ~86 kWh/Monat |
| Bedarf sparsam (1.200 kWh/Jahr) | 100 kWh/Monat → Lücke ~14 kWh ≈ 5,32 €/ Monat |
| Bedarf „typisch“ (1.500 kWh/Jahr) | 125 kWh/Monat → Lücke ~39 kWh ≈ 14,82 €/ Monat |
Warmwasser: Pauschaler Mehrbedarf, reale Mehrkosten – jetzt mit belastbaren Werten
Wird Warmwasser dezentral mit Strom bereitet, gibt es einen pauschalen Mehrbedarf. Für Erwachsene beträgt er 2,3 Prozent des Regelbedarfs – bei 563 € sind das rund 12,95 € pro Monat. In Bestandswohnungen mit elektrischen Durchlauferhitzern liegt der reale Verbrauch jedoch oft deutlich höher als die häufig zitierten 500 kWh pro Jahr. 700 kWh pro Person und Jahr sind als vorsichtiger Richtwert in vielen Altbauten plausibel und beim Bürgergeld als angemessen anzusehen. Je nach Gerätestand, Durchfluss und Duschdauer können es zwischen 500 bis 900 kWh sein. Die Pauschale kann man nur umgehen, wenn man sich auf eigene Kosten einen Zähler nur für den Durchlauferhitzer einbauen lässt, da viele Vermieter diese Kosten nicht tragen wollen.
Zuschuss zum Bürgergeld: Mehrbedarf für Strom beantragen
Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 38 Cent je kWh ergeben sich folgende Monatskosten – und die Lücke zum pauschalen Mehrbedarf:
| Jahresverbrauch DLH | Kosten/Monat | Mehrbedarf/Monat | Unterdeckung/Monat | Unterdeckung/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 500 kWh | 15,83 € | 12,95 € | 2,88 € | 34,60 € |
| 700 kWh | 22,17 € | 12,95 € | 9,22 € | 110,60 € |
| 900 kWh | 28,50 € | 12,95 € | 15,55 € | 186,60 € |
Der pauschale Mehrbedarf für Warmwasser federt nur einen Teil der Stromkostenab. Besonders Singles geraten ins Minus, weil zusätzlich die Grundgebühr des Stromtarifs allein zu tragen ist. In Mehrpersonenhaushalten verteilt sich die Grundgebühr – bei Einpersonenhaushalten belastet sie das Budget voll. Die Unterdeckung potenziert sich, wenn Warmwasser elektrisch bereitet wird und der Arbeitspreis hoch bleibt. Ein nicht angepasster Regelsatz fixiert den Mehrbedarf als Prozentsatz und vergrößert die Lücke real weiter.
Politische Großwetterlage: Nullrunde 2026
Besonders dramatisch ist die geplante Nichtanpassung der Regelbedarfe 2026. Das Bundeskabinett hat eine erneute Nullrunde beschlossen. Für Betroffene ist das eine Katastrophe. Strompreise sinken für Neukunden zwar punktuell, der Haushaltsstrom vieler Bestandskunden bleibt aber hoch – zumal viele Empfänger von Bürgergeld und Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt aufgrund ihrer schlechten Bonität beim ohnehin teuren Grundversorger bleiben müssen. Ohne Anhebung des Stromanteils im Regelbedarf wächst die Lücke real weiter. Gleichzeitig steigen kommunale Gebühren oder Netzentgelte teils an. Wer ohnehin schon knapp kalkulieren muss, wird durch eine zweite Nullrunde in Folge in die Schuldenfalle gedrückt.
Einordnung aus der Erwerbslosenhilfe
Das Problem ist nicht individuelles „Fehlverhalten“. Es ist eingebaut. Einpersonenhaushalte stellen in beiden Grundsicherungssystemen die Mehrheit. Fixe Grundgebühren treffen diese Gruppe überproportional. Der pauschale Warmwasser-Mehrbedarf ist zu niedrig angesetzt, wenn Warmwasser tatsächlich elektrisch bereitet wird. Die Konsequenz ist sichtbar: Mehr Zahlungsrückstände, mehr Sperrandrohungen, steigende Sperren.
Stromnachzahlung mit Bürgergeld – hilft das Jobcenter?
Was kurzfristig hilft: frühe Abschlagsanpassung nach realem Verbrauch, Tarifwechsel aus teurer Grundversorgung, Schuldenregulierung mit Raten statt Darlehen, Energieberatung im Haushalt. Was strukturell fehlt: ein realitätsnaher Stromanteil im Regelbedarf bzw. die Übernahme der Stromkosten als Teil der KdU. Ohne das werden Destatis-Meldungen zu Zahlungsrückständen und Sperren auch 2026 kein Randthema bleiben sondern noch dramatischer ausfallen.