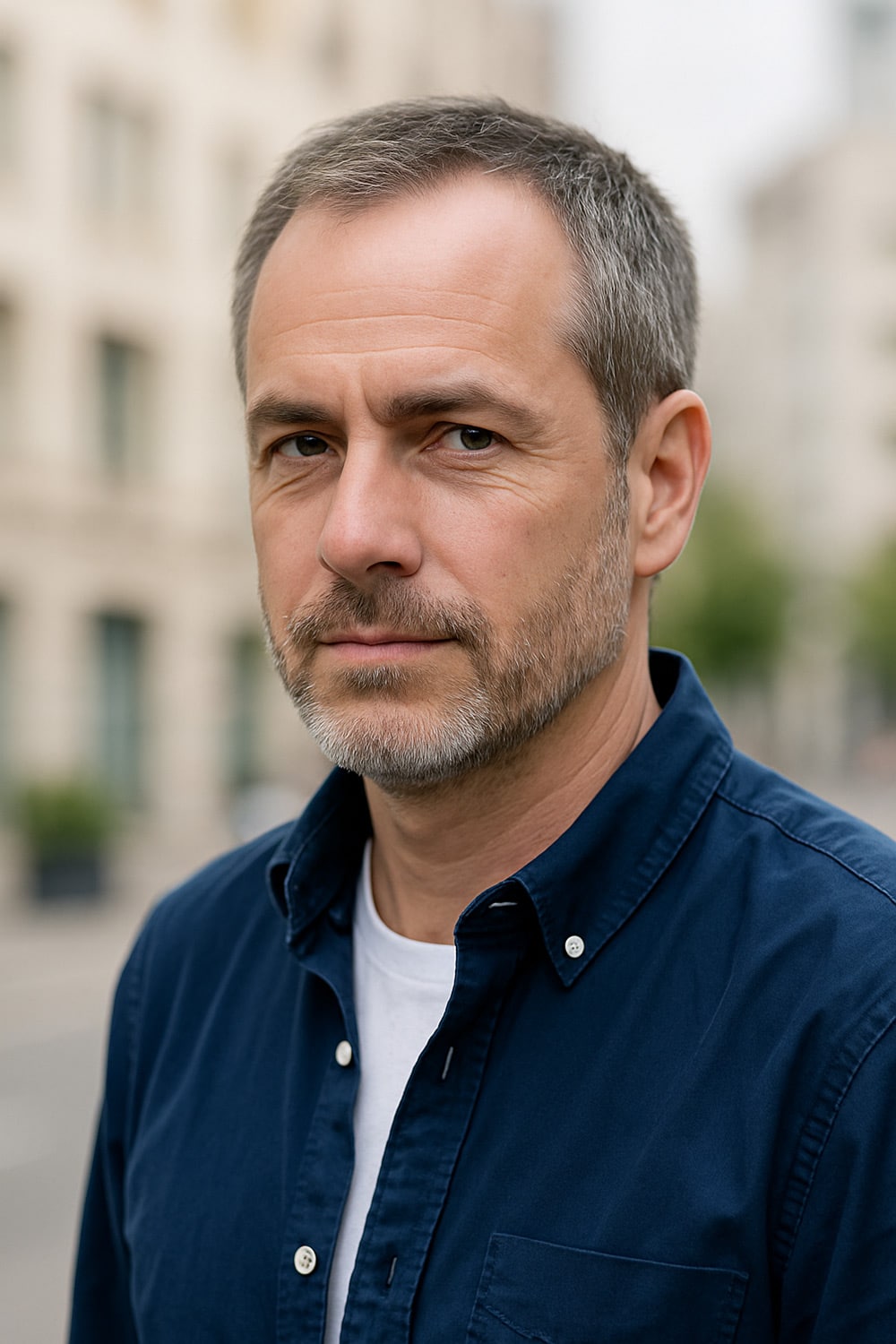Mitte Juli 2025 legte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), eine Studie vor, die eine Milliardenlücke in der gesetzlichen Rentenversicherung prognostiziert, sobald die geburtenstarken Jahrgänge (1955 – 1969, die sogenannten Babyboomer) in den Ruhestand treten. Als Übergangslösung empfehlen die DIW‑Forscher einen zeitlich befristeten Boomer‑Soli – eine Zusatzabgabe auf überdurchschnittliche Rente und Altersbezüge. Doch was steckt genau dahinter und was würde das für Rentner bedeuten?
Inhaltsverzeichnis
Worum geht es überhaupt?
Der DIW‑Vorschlag geht davon aus, dass der Bundeszuschuss zur Rentenkasse bereits ab 2028 um zweistellige Milliardenbeträge steigen muss, wenn alles so bleibt wie bisher. Der Grund: Mehr Menschen beziehen Rente, während die Zahl der Einzahler schrumpft. Um diesen demografischen Knoten zumindest vorübergehend zu lösen, soll eine befristete Zusatzabgabe gezielt jene belasten, deren Alterseinkommen deutlich über dem Durchschnitt liegt.
Rente nach 45 Jahren: Jeder Vierte bleibt unter 1.300 €
So ist der Boomer‑Soli gedacht
Kern des Konzepts ist ein Freibetrag von 1.048 Euro netto im Monat. Alle Altersbezüge – gesetzliche Rente, Betriebsrente oder private Vorsorge – werden addiert. Der Teil oberhalb dieser Schwelle würde mit zehn Prozent belastet. Wer also netto 1.500 Euro Rente erhält, zahlt rund 45 Euro im Monat, bei 3.200 Euro wären es knapp 100 Euro. Die Einnahmen sollen von 2028 bis 2038 in einen Fonds fließen, der niedrige Renten aufstockt oder Beitragssätze stabilisiert.
Rein rechnerisch brächte das Modell acht bis zwölf Milliarden Euro pro Jahr. Das klingt viel, deckt aber nur etwa einen einzigen Rentenmonat – ein Hinweis darauf, dass der Boomer‑Soli bestenfalls ein Zeitpuffer ist, kein Allheilmittel.
Argumente der Befürworter
Befürworter verweisen vor allem auf den Fairness‑Gedanken: Gut versorgte Rentner gäben einen kleinen Teil ihres Überschusses ab, um den Beitragssatz der Kinder‑ und Enkelgeneration zu dämpfen. Außerdem lasse sich die Abgabe ohne Grundgesetzänderung schnell umsetzen. Der Fonds könne gezielt Mini‑Renten erhöhen und damit Altersarmut lindern – eine pragmatische Brücke, weil der demografische Schock nicht wartet, bis das Parlament eine umfassende Reform verabschiedet.
Kritik der Gegenseite
Kritiker sehen im Boomer‑Soli in erster Linie Symbolpolitik und warnen vor Nebenwirkungen. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) spricht von einem „teuren Placebo“, Rentenökonom Prof. Bernd Raffelhüschen im WELT-Interview gar von einer „Scheinlösung“.
Darüber hinaus drohe ein Vertrauensbruch. Wer jahrzehntelang privat vorgesorgt habe, müsse nun doch abgeben. Verfassungsrechtlich ist nicht alles geklärt, denn Beamtenpensionen genießen besonderen Schutz.
Mathematik kann man mit Koalitionsverträgen nicht aushebeln.
Thorsten Alsleben (INSM‑Geschäftsführer)
Man kann Menschen nicht allein wegen ihres Geburtsjahres höher besteuern.
Prof. Bernd Raffelhüschen (Uni Freiburg)
DIW-Präsident Marcel Fratzscher sprach von einem „fairen Ausgleich, der jüngere Generationen entlastet“ und unterstützte den Vorschlag via X.
Kleine Rente mit Wohngeld oder Grundsicherung aufstocken
Hauptkritikpunkte auf einen Blick
- Doppelbelastung: Rentner zahlen bereits Einkommensteuer plus Kranken‑/Pflegeversicherung. Ein neuer Aufschlag wirkt wie eine nachträgliche Vermögensteuer.
- Verfassungsrisiko: Beamtenpensionen genießen besonderen Eigentumsschutz. Ein Eingriff könnte vor dem Bundesverfassungsgericht landen.
- Vertrauensbruch: Viele Babyboomer haben zusätzlich privat vorgesorgt. Eine rückwirkende Abgabe schmälert die Planungssicherheit.
- Geringe Wirkung: 8 – 12 Mrd. Euro decken weniger als 4 Prozent der Jahresausgaben der Rentenkasse. Ohne Strukturreform bleibt das Loch.
- Wirtschaftlicher Bumerang: Höhere Abgaben bremsen Konsum‑ und Investitionsbereitschaft älterer Haushalte.
Politisch gilt der Plan zudem als heikel: Rund 21 Millionen Babyboomer bilden das größte Wählersegment – keine Regierung legt sich leichtfertig mit ihnen an.
Blick nach vorn
Selbst die Autoren der DIW‑Studie betonen, dass der Boomer‑Soli keine Dauerlösung ist. Notwendig bleibt ein Bündel von Maßnahmen: ein flexibleres Renteneintrittsalter, das an die höhere Lebenserwartung gekoppelt wird, bessere Erwerbschancen vor allem für Frauen und Geringqualifizierte, und eine tragfähige kapitalgedeckte Säule, Stichwort Aktienrente. Erst das Zusammenspiel dieser Bausteine macht das System wetterfest.