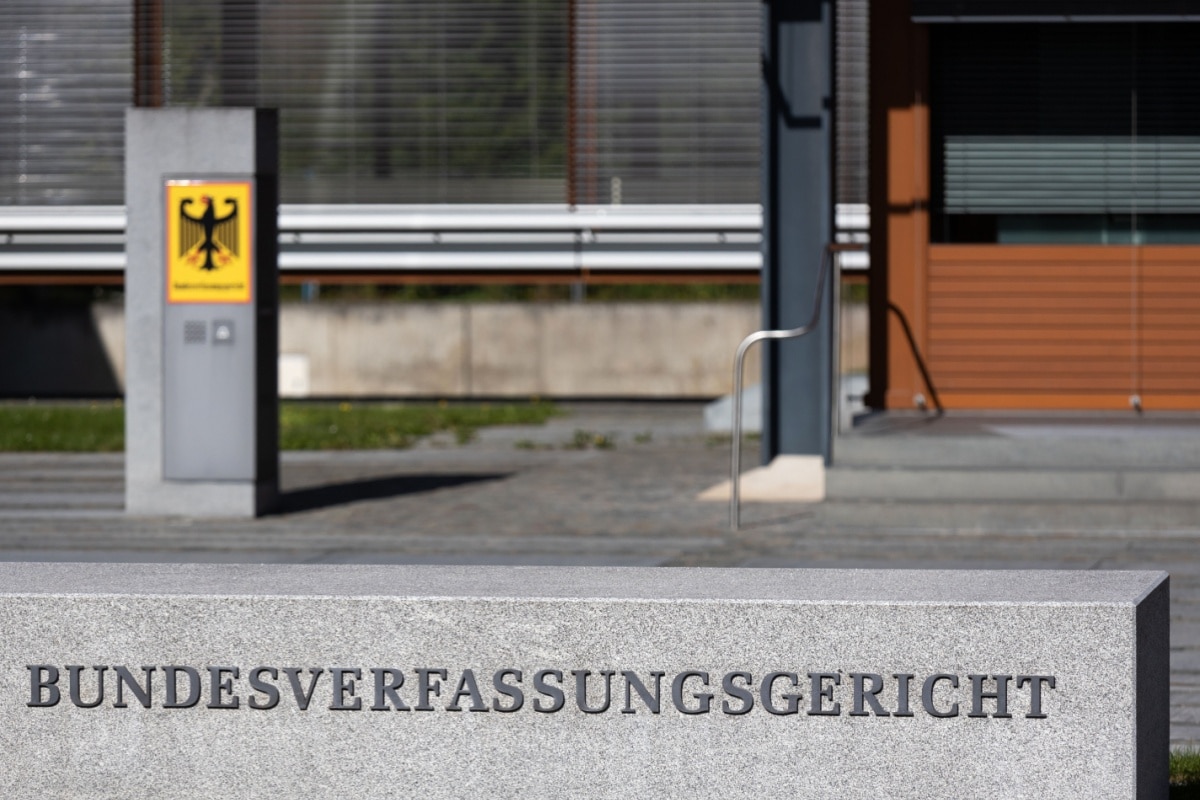Ein Räumungstitel reicht künftig nicht mehr: Wenn Leib und Leben auf dem Spiel stehen, kann das Bundesverfassungsgericht die Stopp-Taste drücken und die Zwangsräumung der Mietwohnung aussetzen. Das zeigt ein Beschluss vom 18. Mai 2025 (Az. 2 BvQ 32/25), der die für den 19. Mai 2025 angesetzte Zwangsräumung einer hochschwangeren Frau in Schwabach um bis zu sechs Monate aussetzt.
Container als Notunterkunft nicht zumutbar
Das Amtsgericht Schwabach hatte auf Antrag des Vermieters die Räumung der Wohnung einer fränkischen Familie angesetzt, obwohl die werdende Mutter kurz vor einem Kaiserschnitt stand. Als Ersatzwohnung bot die Kommune lediglich einen ungedämmten Container ohne nachgewiesene medizinische oder hygienische Mindeststandards an.
Für die Verfassungsrichter in Karlsruhe war das zu wenig: Ohne belastbare Fakten zur Sicherheit von Mutter und Kind dürfe nicht vollstreckt werden. Im Zentrum steht dabei das Grundrecht der Mieterin auf körperliche Unversehrtheit.
Der Beschluss erging als einstweilige Anordnung im Eilverfahren; die Familie hat nun einen Monat Zeit, eine Verfassungsbeschwerde einzureichen – erst dann prüft Karlsruhe die Sache unter einem neuen Aktenzeichen in der Hauptsache.
Karlsruher Richter nehmen Bürgergeld-Regelsatz auseinander – Ministerium unter Druck
Verfassungsrechtliches Gewicht
Drei Vorschriften tragen die Entscheidung. Das Bundesverfassungsgericht verknüpft in seinem Beschluss drei Normenketten zu einem dicken Rettungsseil:
- Art. 2 Abs. 2 GG schützt das Leben und die körperliche Unversehrtheit sowohl der Mutter als auch des ungeborenen Kindes – und bildet hier das Grundrecht der Mieterin, das Vorrang beansprucht.
- § 765a ZPO erlaubt, eine Vollstreckung aufzuschieben, wenn sie unter den konkreten Umständen unzumutbar wäre.
- § 32 BVerfGG gibt dem Gericht das Instrument der einstweiligen Anordnung, wenn der drohende Schaden schwerer wiegt als die Nachteile einer Verzögerung.
Im Klartext: Wo elementare Gesundheitsrisiken nachweislich im Raum stehen, hat das Eigentumsrecht des Vermieters vorübergehend zurückzutreten.
Was der Beschluss auslöst
Mit seiner Entscheidung erinnert das Bundesverfassungsgericht daran, dass Wohnungen zwar gekündigt werden können – das Grundrecht der Mieterin auf Würde und Gesundheit jedoch nicht. Für künftige Räumungsverfahren dürfte deshalb gelten: erst prüfen, dann räumen.
Gerichte müssen genauer hinschauen. Pauschale Verweise auf „fehlende Dringlichkeit“ genügen nicht mehr; werden konkrete Gesundheitsrisiken geltend gemacht, sind sie – notfalls mithilfe eines Sachverständigengutachtens – sorgfältig abzuklären.
Kommunen brauchen tragfähige Notlösungen. Ein Container ohne belastbare Nachweise zu Hygiene, Heizung und medizinischer Erreichbarkeit liegt unterhalb des verfassungsrechtlichen Mindeststandards.
Vermieter müssen sich darauf einstellen, dass selbst ein formell einwandfreier Räumungstitel nicht zwangsläufig sofort vollstreckt wird, sobald substantielle Härtegründe im Raum stehen. Verzögerungen und Mehrkosten können dadurch zur Realität werden – nicht als Strafe, sondern als Konsequenz grundrechtlicher Abwägung.
Kein Freifahrtschein, aber ein deutlicher Weckruf
Der Beschluss garantiert Betroffenen nicht automatisch einen Aufschub. Das Bundesverfassungsgericht betont ausdrücklich, dass eine Räumung möglich bleibt, wenn geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Gefahr für Mutter und Kind auszuräumen – etwa durch eine belegbar angemessene Ersatzunterkunft oder lückenlose medizinische Betreuung.
Doch der Präzedenzfall verschiebt die Beweislast: Nicht die Schwangere muss unter Zeitdruck ihre Gefährdung belegen, sondern Vollstreckungsgericht und Gerichtsvollzieher müssen darlegen, dass die angebotene Lösung zumutbar ist – und damit dem Grundrecht der Mieterin gerecht wird.
Bürgergeld: Keine Übernahme von Mietschulden bei Kündigung
Beschwerde – Frist und Hauptverfahren
Der Beschluss ist ein reines Eilverfahren: Die Räumung bleibt „bis zur Entscheidung über die noch einzulegende Verfassungsbeschwerde, längstens jedoch für sechs Monate“ ausgesetzt. Die Familie hat jetzt einen Monat Zeit, eine Hauptsachebeschwerde einzureichen.
- Ohne Beschwerde endet der Schutz automatisch nach spätestens sechs Monaten; der Vermieter kann die Räumung dann neu anstoßen.
- Mit Beschwerde bleibt die Sperre zwar bestehen – fällt aber sofort, sobald Karlsruhe in der Hauptsache entscheidet, selbst wenn das schon nach wenigen Wochen geschieht und sogar dann, wenn die Beschwerde abgewiesen wird.
- Nachbesserung der Kommune: Verbessert die Stadt die Ersatzunterkunft so deutlich, dass keine Gesundheitsgefahr mehr besteht, kann das Bundesverfassungsgericht die Anordnung auf Antrag des Vermieters (oder sogar von Amts wegen) ändern oder aufheben. In diesem Fall entfiele der Räumungsschutz ebenfalls vorzeitig, weil der Grundrechtseingriff erledigt wäre.
Wichtig: Das Gericht hat nicht den Räumungstitel selbst in Frage gestellt, sondern nur dessen Vollstreckung eingefroren. In der Hauptsache würde Das Bundesverfassungsgericht den Kündigungsgrund nur dann prüfen, wenn es einen eigenständigen, schwerwiegenden Grundrechtsverstoß sieht – und genau das ist selten: Weniger als fünf Prozent aller Verfassungsbeschwerden gelangen überhaupt zur Entscheidung, noch seltener werden fachgerichtliche Urteile vollständig aufgehoben.
Ergebnis: Eine Beschwerde eröffnet zwar die Chance auf dauerhaften Schutz, birgt aber zwei Risiken – eine schnelle negative Hauptsacheentscheidung oder eine Nachbesserung der Kommune, die das Verfahren gegenstandslos macht. Die Erfolgsaussichten bleiben deshalb trotz der aktuellen Atempause eher verhalten.
Verfahrenshergang:
- Amtsgerichts Schwabach – Az.: 1 C 379/23 vom 18.01.2024
- BVerfG – Az.: 2 BvQ 32/25 vom 18.05.2025