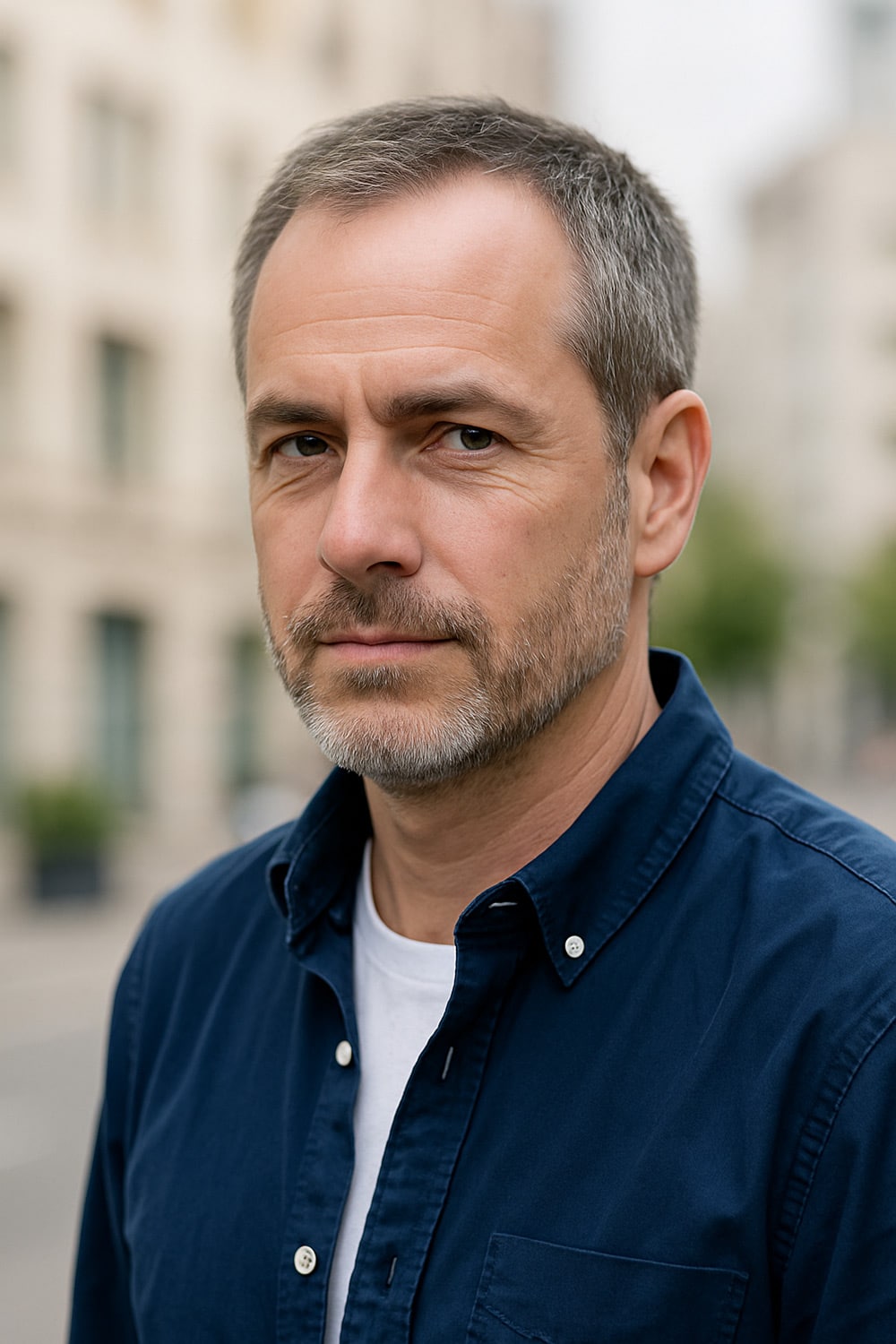Hohe Einmalzahlung – und plötzlich fällt die Erwerbsminderungsrente niedriger aus. Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 25.09.2025 (Az. B 5 R 15/24 R) den Streit um nachträglich ausgezahlte Überstunden für die Praxis sortiert: Entscheidend ist, welchem Arbeitsverhältnis die Zahlung rechtlich zugeordnet wird. Kommt die Abgeltung aus einem während des Rentenbezugs fortbestehenden Job, gilt sie als Hinzuverdienst und kann die Rente kürzen.
Inhaltsverzeichnis
Der konkrete Sachverhalt
Im Ausgangsfall aus Sachsen-Anhalt wurden 33.529,75 € brutto ausgezahlt – über Jahre angesammelte Mehrarbeit, die im Jahr 2021 zur Auszahlung kam. Die Rentenversicherung rechnete die Summe als Hinzuverdienst auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung an. Damals galt noch die starre Jahresgrenze von 6.300 € für die volle EM-Rente. Alles darüber wirkte sich mindernd aus.
Am selben Verhandlungstag zog die Rentenversicherung in einem Parallelverfahren (Az. B 5 R 12/24 R) ihre Revision zurück. Dort ruhte das Arbeitsverhältnis tariflich. In solchen Konstellationen wird eine Einmalzahlung meist nicht als Hinzuverdienst zur EM-Rente angerechnet, weil sie rechtlich nicht zum laufenden Arbeitsverhältnis im Rentenzeitraum gehört.
Erwerbsminderungsrente – Voraussetzungen, Höhe und Antrag
Einfach erklärt: Wann zählt eine Einmalzahlung als Hinzuverdienst?
Die Kernfrage lautet: Wem „gehört“ die Zahlung rechtlich und zeitlich?
- Laufender Job während des Rentenbezugs: Einmalzahlungen wie Überstundenabgeltungen gelten in der Regel als Arbeitsentgelt aus diesem Job – damit als Hinzuverdienst. Die Rente kann gekürzt werden.
- Ruhendes oder beendetes Arbeitsverhältnis bzw. klar vor Rentenbeginn erarbeitete Ansprüche, die nicht dem laufenden Job zugeordnet sind: Solche Zahlungen werden meist nicht angerechnet, weil sie rechtlich nicht zum Rentenzeitraum gehören.
Wichtig ist also nicht der Monat der Auszahlung, sondern die rechtliche Zuordnung der Zahlung. Darauf stellt das BSG ausdrücklich ab.
So wirkt sich das finanziell aus: Rechnung nach altem Recht
Für 2021 galt (wie im Sachverhalt) bei voller EM-Rente die Jahresgrenze von 6.300 €. Der übersteigende Teil wurde zu 40 % auf die Rente angerechnet. Die Anrechnung erfolgt kalenderjährlich, indem der Jahresüberschuss durch zwölf geteilt wird.
Rechenbeispiel mit der im Verfahren genannten Summe (vereinfacht):
33.529,75 € − 6.300,00 € = 27.229,75 € Überschreitung
27.229,75 € ÷ 12 = 2.269,15 € monatlicher Überschuss
40 % von 2.269,15 € = 907,66 € monatliche Kürzung der EM-Rente
Ob zusätzlich ein Hinzuverdienst-Deckel greift, hängt von der individuellen Rentenhöhe ab. Nach Ende des Kalenderjahres kann die Rente wieder ungekürzt fließen, wenn keine neue Überschreitung vorliegt.
Hinzuverdienst bei der EM-Rente seit 2023 neu geregelt
Die frühere 6.300-€-Grenze entfällt. Seit 01.01.2023 richtet sich die Jahresgrenze bei voller EM-Rente nach einer festen Formel: drei Achtel der 14-fachen monatlichen Bezugsgröße. Für 2025 ergibt das 19.661,25 € bei voller EM. Bei teilweiser EM gilt weiterhin eine individuelle Grenze, mindestens 39.322,50 €. Einmalzahlungen bleiben prüfpflichtig, führen aber seltener zu Kürzungen als früher.
| Jahr | Volle EM – jährliche Grenze | Teilweise EM – jährliche Grenze |
|---|---|---|
| 2021 | 6.300 € (starr) | individuell |
| 2025 | 19.661,25 € (dynamisch) | mind. 39.322,50 € |
Kurz erklärt: Was ist die Bezugsgröße?
Die Bezugsgröße ist ein gesetzlich festgelegter Rechenwert für die Sozialversicherung. Vereinfacht gesagt entspricht sie dem durchschnittlichen Jahresarbeitsentgelt in der gesetzlichen Rentenversicherung aus dem vorvergangenen Jahr, technisch auf einen runden Betrag gebracht. Viele Schwellen und Grenzen werden daraus abgeleitet – auch die Hinzuverdienstgrenze bei der EM-Rente. Für 2025 beträgt die Bezugsgröße 44.940 € im Jahr bzw. 3.745 € im Monat. Nachlesen lässt sich das in § 18 SGB IV sowie in der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2025. Die Deutsche Rentenversicherung und Krankenkassen veröffentlichen die aktuellen Zahlen zudem in ihren Übersichten.
Erwerbsminderungsrente: Hinzuverdienstgrenzen 2025 & 2026
Praxis: Woran Betroffene denken sollten
Zentral ist die Zuordnung der Zahlung. Lohnabrechnungen, Arbeits- oder Tarifverträge und – wenn möglich – eine Bestätigung des Arbeitgebers, welchem Zeitraum und welchem Arbeitsverhältnis die Zahlung zugeordnet wird, sind entscheidend. In Bescheiden der Rentenversicherung sollte geprüft werden, ob diese Zuordnung korrekt bewertet wurde. Gegen Bescheide ist innerhalb eines Monats Widerspruch möglich.
Bei planbaren Einmalzahlungen lohnt der Blick auf das Kalenderjahr. Gelingt eine Verschiebung innerhalb der arbeits- und steuerrechtlichen Möglichkeiten, kann die Einhaltung der Jahresgrenze gelingen. Bei teilweiser EM-Rente ist die individuelle Hinzuverdienstgrenze maßgeblich, die die DRV aus der Entgeltbiografie berechnet.
Einordnung und Fazit zur BSG Entscheidung
Das BSG schafft dringend benötigte Klarheit. Die Kehrseite: Wer viele Jahre zuvor Überstunden geleistet hat, spürt eine späte Auszahlung möglicherweise im falschen Jahr – trotz neuer, höherer Grenzen. Positiv ist die präzisere Trennlinie für ruhende oder beendete Arbeitsverhältnisse. Damit werden Zahlungen, die tatsächlich nicht zum laufenden Job im Rentenzeitraum gehören, in der Regel nicht mehr auf die EM-Rente angerechnet.